|
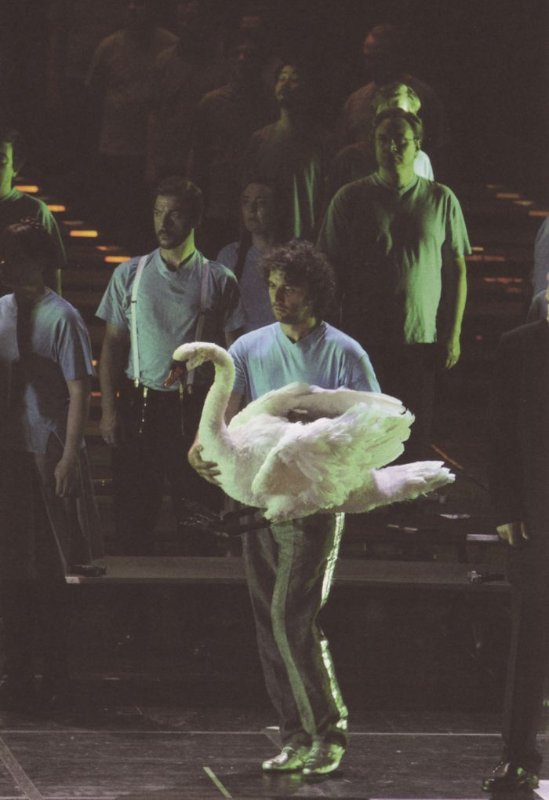 „O
fänd’ ich Jubelweisen“ zitiert der Kritiker gerne aus Richard Wagners
Lohengrin-Text, wenn es um die musikalische Seite geht: vom fein geteilten
Streicher-Pianissimo bis zum fulminanten Jubel des dritten Vorspiels bewies
das glänzend disponierte Staatsorchester, dass es auch heute noch einen
König Ludwig II. wie einst zu Tränen rühren könnte und mit dem eben nicht
für den verdeckten Bayreuther Orchestergraben komponierten „Lohengrin“
weltweit keine Konkurrenz zu scheuen braucht. Kent Nagano dirigierte klar,
sehr differenziert abgestuft, aber etwas distanziert kühl. Er bekam sogar
den nicht immer günstig, weil mehrfach hoch entfernt auf einer hölzernen
Bahnsteig-Brücke postierten, aber von Andrés Máspero bestens einstudierten
Chor akustisch wie rhythmisch weitgehend in den Griff. Und dann noch die
Besetzung: Wolfgang Koch – der beste mal cholerische, mal jovial
hemdsärmelige Telramund seit Jahren; Christof Fischesser – ein junger, aber
schon herrlich markanter König Heinrich im Senatoren-Look; Evgeny Nikitin –
ein volltönender Heerrufer-Bürokrat auf einem Schiedsrichterhochstuhl und
via Bildschirm; Michaela Schuster eine elegant giftblond kühle Ortrud; Anja
Harteros – eine schwarzbezopfte Elsa in schwarzer Latzhose mit mal zarter,
mal strahlend leuchtender Sopran-Süße für ihre Eigenheim-Fixierung, an der
sie zwei Aufzüge lang mauerte… ja und dann dieser äußerlich entzauberte
Wundermann: erstmal in silbernen Edelturnschuhen, Trainingshose mit
Silberstreifen und schlichtem blauen T-Shirt, später dann in schwarzer
Arbeitshose und Weste mit weißem Blouson wie ein wandernder Handwerksbursch
des 19. Jahrhunderts, zunächst mit einer Schwan-Attrappe auf dem Arm
kommend, am Ende damit abgehend und dann schnell mal mit dem Knaben
Gottfried auf dem Arm wiederkommend – zu all dem aber sang der schlank-ranke
Jonas Kaufmann mal mit der Süße eines Sandor Konya, mal mit der Strahlkraft
eines jungen James King, am Ende eine anrührend traurig versunkene
„Grals-Erzählung“. Das Premierenpublikum fand für all das zurecht
Jubelweisen… „O
fänd’ ich Jubelweisen“ zitiert der Kritiker gerne aus Richard Wagners
Lohengrin-Text, wenn es um die musikalische Seite geht: vom fein geteilten
Streicher-Pianissimo bis zum fulminanten Jubel des dritten Vorspiels bewies
das glänzend disponierte Staatsorchester, dass es auch heute noch einen
König Ludwig II. wie einst zu Tränen rühren könnte und mit dem eben nicht
für den verdeckten Bayreuther Orchestergraben komponierten „Lohengrin“
weltweit keine Konkurrenz zu scheuen braucht. Kent Nagano dirigierte klar,
sehr differenziert abgestuft, aber etwas distanziert kühl. Er bekam sogar
den nicht immer günstig, weil mehrfach hoch entfernt auf einer hölzernen
Bahnsteig-Brücke postierten, aber von Andrés Máspero bestens einstudierten
Chor akustisch wie rhythmisch weitgehend in den Griff. Und dann noch die
Besetzung: Wolfgang Koch – der beste mal cholerische, mal jovial
hemdsärmelige Telramund seit Jahren; Christof Fischesser – ein junger, aber
schon herrlich markanter König Heinrich im Senatoren-Look; Evgeny Nikitin –
ein volltönender Heerrufer-Bürokrat auf einem Schiedsrichterhochstuhl und
via Bildschirm; Michaela Schuster eine elegant giftblond kühle Ortrud; Anja
Harteros – eine schwarzbezopfte Elsa in schwarzer Latzhose mit mal zarter,
mal strahlend leuchtender Sopran-Süße für ihre Eigenheim-Fixierung, an der
sie zwei Aufzüge lang mauerte… ja und dann dieser äußerlich entzauberte
Wundermann: erstmal in silbernen Edelturnschuhen, Trainingshose mit
Silberstreifen und schlichtem blauen T-Shirt, später dann in schwarzer
Arbeitshose und Weste mit weißem Blouson wie ein wandernder Handwerksbursch
des 19. Jahrhunderts, zunächst mit einer Schwan-Attrappe auf dem Arm
kommend, am Ende damit abgehend und dann schnell mal mit dem Knaben
Gottfried auf dem Arm wiederkommend – zu all dem aber sang der schlank-ranke
Jonas Kaufmann mal mit der Süße eines Sandor Konya, mal mit der Strahlkraft
eines jungen James King, am Ende eine anrührend traurig versunkene
„Grals-Erzählung“. Das Premierenpublikum fand für all das zurecht
Jubelweisen…
Kopfschütteln, verbitterte Zwischenrufe und dann Buhstürme für das
Bühnenteam. Der seit seinem „Dino-Giulio Cesare“ 1994 in München geschätzte,
oft mit seinen Neudeutungen beeindruckende Richard Jones und sein Bühnenteam
glauben in unseren entromantisierten, entmystifizierten und dafür
materialistischen Zeiten nicht an Wunder samt Schwanenritter. Doch dafür
einen Handwerksburschen anzubieten, der einer prompt kleinbürgerlich
wirkenden Elsa beim Häusle-Bauen hilft – das wirkte so banal und schlicht,
dass es auch den konservativen Opernliebhaber, erst recht den
Musiktheaterfreund ärgerlich unterforderte. Dazu viele lose Enden, die nicht
ausgeführt wirkten: moderne Repetierpistolen neben Degen und Gottesgericht
in Form von Schwertertanz; grässliche Büromöbel für hochgestochene Rituale
im Kontrast zu mehrfach Live-TV-Aufwand; eine unergiebige
bühnenüberspannende Holzbrücke über der Baustelle, die dann auch noch
aufwändig hochgefahren werden muss, um per Kran das letzte Dachteil mit
Sonnenkollektoren zu installieren – und durchweg viel Mauerarbeiten, als ob
die Sänger eine Zweitausbildung als soziale Absicherung bekommen sollen; am
Ende gar die Andeutung eines kollektiven Selbstmords des brabantischen
Chorvolks und und und... Nichts von der Schwierigkeit einer „numinosen
Herrschaft“ (Udo Bermbach), nichts von der Aura eines „Gestalters“, der
zumindest versucht, unsere verfahrene Welt ins Lot zu bringen. Wären heute
aber nicht gerade Künstler mit dem „Lohengrin“ zu einer Utopie
herausgefordert? Um die Bau-Banalitäten von Richard Jones zu lösen wäre das
erste: Bitte mehr Kran als Schwan! Und dann bitte mehr visionäre Ideen! |
