|
|
|
|
|
|
|
| Rondo Magazin, 30.11.2007 |
| Christoph Braun |
|
|
Franz Schubert: Fierrabras
|
|
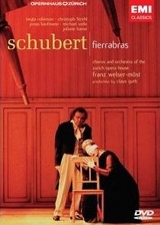 Einige
wenige geniale Regie-Einfälle – und ein reichlich angestaubtes,
"heroisch-romantisches" Ritter-Kreuzzugsdrama zu Zeiten Karls des Großen
erwacht zu neuem Leben, ja wird sogar zum packenden Psychodrama. Claus Guth
gelang vor zwei Jahren das Kunststück am Zürcher Opernhaus, als er
"Fierrabras", Schuberts vorletztes, 1823 komponiertes Bühnenwerk
inszenierte. Dessen krudes Sujet um zwei fränkische Ritter und ihre
maurischen, also zu christianisierenden Kollegen, die unzulässigerweise
jeweils in die un- bzw. rechtgläubigen Königstöchter verliebt sind, darob
mit ihren und deren Vätern reichlich Ärger kriegen, untereinander
konkurrieren, Freundschaft schließen, diese verraten, im Krieg fast zu Tode
kommen, endlich aber den Friedensschluss ihrer Völker und natürlich auch
ihre Paarbildung feiern – dieses Tohuwabohu Josef Kupelwiesers verlagerte
Guth ins private Ambiente der Schubert’schen Komponierstube, in der der
Komponist selbst zum zentralen Thema seiner Oper wird: als Titelheld, der
zwar alles, auch die letztlich glücklichen Geschicke seiner
"Schubertiade"-Freunde, arrangiert (und den Protagonisten ihre Rollen bzw.
Notenblätter zuteilt), der selbst aber leer ausgeht und ein vereinsamter
Außenseiter bleibt, der sein Leben lang vergeblich um väterliche Anerkennung
ringt. Die Eindringlichkeit dieses Guth‘schen "Schubert-Dramas" wird durch
die Musik (die trotz Claudio Abbados Pioniertat von 1988 nach wie vor kaum
bekannt ist) nochmals gesteigert, lässt Schubert doch eine "offizielle", in
Dur und Marschmotivik strahlende Sphäre mit einer "privaten" kontrastieren,
die entweder (wie bei den weiblichen Protagonisten und den Liebesduetten)
wahrhaft anrührend-unschuldig ist oder von wehmütiger, hoffnungsloser Trauer
des Vereinsamten kündigt. Franz Welser-Möst kümmert sich bestens sowohl
um die intimen, von warmen Holzbläsern getragenen, wie auch um die
dramatischen Klangfarben, seine Sängerriege bleibt mit Ausnahme der offenbar
etwas indisponierten Juliane Banse makellos. So dass von einem Züricher
Glücksgriff gesprochen werden muss, der dem Werk jetzt endlich zu jenem
Bühnenrecht verhelfen müsste, das seinen "Fidelio"- oder
"Freischütz"-Zeitgenossen schon längst zuteil geworden ist. Einige
wenige geniale Regie-Einfälle – und ein reichlich angestaubtes,
"heroisch-romantisches" Ritter-Kreuzzugsdrama zu Zeiten Karls des Großen
erwacht zu neuem Leben, ja wird sogar zum packenden Psychodrama. Claus Guth
gelang vor zwei Jahren das Kunststück am Zürcher Opernhaus, als er
"Fierrabras", Schuberts vorletztes, 1823 komponiertes Bühnenwerk
inszenierte. Dessen krudes Sujet um zwei fränkische Ritter und ihre
maurischen, also zu christianisierenden Kollegen, die unzulässigerweise
jeweils in die un- bzw. rechtgläubigen Königstöchter verliebt sind, darob
mit ihren und deren Vätern reichlich Ärger kriegen, untereinander
konkurrieren, Freundschaft schließen, diese verraten, im Krieg fast zu Tode
kommen, endlich aber den Friedensschluss ihrer Völker und natürlich auch
ihre Paarbildung feiern – dieses Tohuwabohu Josef Kupelwiesers verlagerte
Guth ins private Ambiente der Schubert’schen Komponierstube, in der der
Komponist selbst zum zentralen Thema seiner Oper wird: als Titelheld, der
zwar alles, auch die letztlich glücklichen Geschicke seiner
"Schubertiade"-Freunde, arrangiert (und den Protagonisten ihre Rollen bzw.
Notenblätter zuteilt), der selbst aber leer ausgeht und ein vereinsamter
Außenseiter bleibt, der sein Leben lang vergeblich um väterliche Anerkennung
ringt. Die Eindringlichkeit dieses Guth‘schen "Schubert-Dramas" wird durch
die Musik (die trotz Claudio Abbados Pioniertat von 1988 nach wie vor kaum
bekannt ist) nochmals gesteigert, lässt Schubert doch eine "offizielle", in
Dur und Marschmotivik strahlende Sphäre mit einer "privaten" kontrastieren,
die entweder (wie bei den weiblichen Protagonisten und den Liebesduetten)
wahrhaft anrührend-unschuldig ist oder von wehmütiger, hoffnungsloser Trauer
des Vereinsamten kündigt. Franz Welser-Möst kümmert sich bestens sowohl
um die intimen, von warmen Holzbläsern getragenen, wie auch um die
dramatischen Klangfarben, seine Sängerriege bleibt mit Ausnahme der offenbar
etwas indisponierten Juliane Banse makellos. So dass von einem Züricher
Glücksgriff gesprochen werden muss, der dem Werk jetzt endlich zu jenem
Bühnenrecht verhelfen müsste, das seinen "Fidelio"- oder
"Freischütz"-Zeitgenossen schon längst zuteil geworden ist. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|